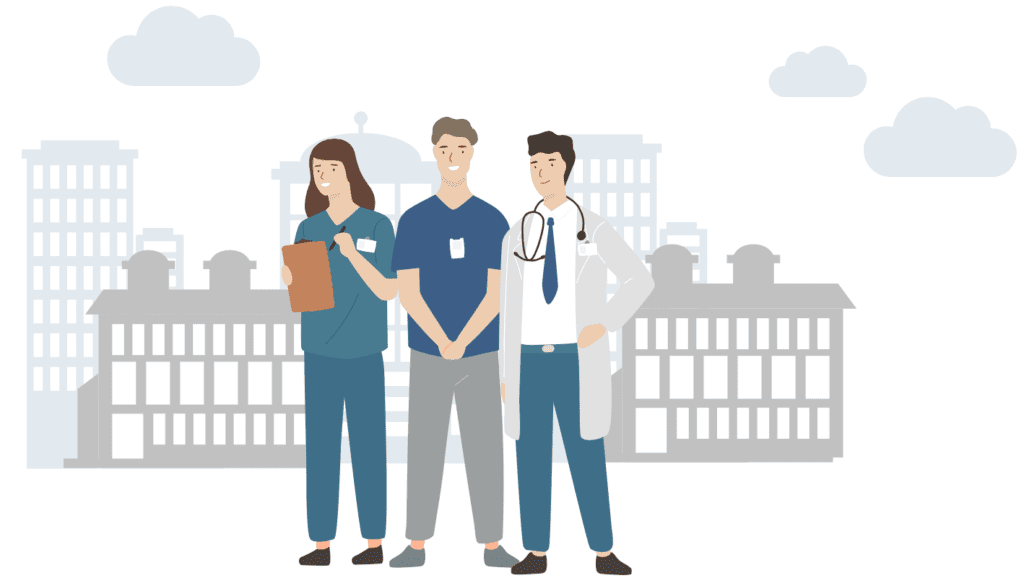Motivationsphase
Das Eingestehen der Alkoholsucht und die Suche nach Unterstützung sind die ersten Schritte zu einem Leben ohne Alkohol. Wer selbst Suchtanzeichen bemerkt, kann eine mögliche Alkoholabhängigkeit z. B. durch einen anonymen Test, einen Besuch beim Hausarzt oder einer Suchtberatungsstelle feststellen lassen.
Diagnostik
Eine sichere Diagnose ist durch Fragen zum Trinkverhalten, eine körperliche Untersuchung beim Hausarzt und Labordiagnostik (z. B. Gamma-GT, MCV, CDT) oder eine kurze Psychodiagnostik (Audit, Audit- C) möglich. Sodann wird der behandelnde Mediziner oder Therapeut den Betroffenen mit den Untersuchungsergebnissen konfrontieren und entsprechende Empfehlungen aussprechen. So kann der weitere Umgang mit dem übermäßigen Alkoholkonsum, zum Beispiel die Wahl einer passenden Alkoholtherapie oder die Einweisung in ein Krankenhaus oder eine Entzugsklinik, besprochen und eingeleitet werden.
Entscheidung für eine Therapie
Aus der Erfahrung heraus entscheiden sich viele Alkoholkranke frühestens nach einem langen Prozess zu einer Alkoholismus-Therapie. Erst, wenn Körper und Psyche stark angegriffen oder alle gesellschaftlichen Kontakte weggebrochen sind, kommt eine Abstinenz für sie überhaupt in Frage. Auslöser für einen Alkoholentzug können im Sinne erlebter oder drohender Konsequenzen neben körperlichen und psychosomatischen Erkrankungen zum Beispiel Führerschein- oder Jobverlust, Therapieauflagen, Trennung des Partners oder drohender Kindesentzug sein.
Entgiftungsphase
Die Entgiftung erfolgt in der Regel in einem darauf spezialisierten Krankenhaus oder einer Klinik. Die Dauer der Alkoholentgiftung richtet sich nach den individuellen Voraussetzungen, die im Rahmen einer umfangreichen Aufnahmeuntersuchung ermittelt werden. Die Diagnostik umfasst u. a. den Bereich der Inneren Medizin, diverse Funktionstests, Labordiagnostik, Ultraschall- und EKG- Untersuchungen.
Überwachung des Gesundheitszustandes
Während der Alkoholentgiftung wird der Gesundheitszustand des Alkoholsüchtigen von den Ärzten engmaschig kontrolliert, so dass bei eventuellen Komplikationen oder starken Entzugserscheinungen sofort eingegriffen werden kann. In den meisten Krankenhäusern wird die Schwere der Entzugssymptome und der daraus resultierende Behandlungsbedarf nach der Alkohol-Entzugs-Skala (AES) beurteilt. Um die Entzugserscheinungen zu lindern, wird die Entzugsphase üblicherweise durch Medikamente unterstützt.
Gefährlicher Mischkonsum verlangt nach besonderer Aufmerksamkeit
Bei Vorliegen eines multiplen Substanzmissbrauchs, bei dem weitere rauscherzeugende Substanzen (regelmäßig) konsumiert werden, kann es während des Entzugs zu komplexen Nebenwirkungen kommen. Umso wichtiger ist hier das stationäre Setting, bei dem eine lückenlose Überwachung sämtlicher Vitalparameter sowie eine umfassende medikamentöse Behandlung gegeben sind.
Beginn der psychischen Entwöhnung
Direkt an die Entgiftung sollte sich eine weiterführende ambulante oder stationäre Entwöhnung in einer öffentlichen Einrichtung oder einer privaten Entzugsklinik anschließen, damit der Alkoholkranke aufgrund seiner nach wie vor bestehenden psychischen Abhängigkeit nicht rückfällig wird.
Entwöhnungsphase
Der nächste Schritt des Alkoholentzugs befasst sich mit der Alkoholentwöhnung. In dieser Phase ist die körperliche Abhängigkeit überwunden, eine seelische Abhängigkeit vom Suchtmittel besteht jedoch weiterhin. In der Regel beginnt nun im Rahmen einer längerfristigen Reha-Maßnahme die sogenannte Entwöhnungsphase, welche meist 3 bis 4 Monate dauert und der bei öffentlichen Einrichtungen häufig eine mehrwöchige Wartezeit vorgelagert ist. Der Betroffene lernt im Rahmen der Alkoholentwöhnung beim Psychologen, wie er in sein vorheriges, suchtfreies Leben zurückkehren und dauerhaft abstinent bleiben kann.
Entwöhnung und Entgiftung in privaten Entzugskliniken gekoppelt
In privaten Entzugskliniken wird alternativ zu der gerade beschriebenen Methode eine Entwöhnung angeboten, die sich direkt an die Alkoholentgiftung anschließt, so dass eine durchgängige multiprofessionelle Behandlung gewährleistet und die Alkoholtherapie innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen ist. Dabei wird die Tatsache genutzt, dass sich der Suchtkranke durch den vorhergehenden Aufenthalt in der jeweiligen Einrichtung seinem Alkoholproblem völlig geöffnet hat.
Rückfälle in der Wartezeit, in der sich der Therapiewiderstand des Alkoholkranken möglicherweise wieder erhöht, werden auf diese Weise vermieden. Die Möglichkeit, nahtlos bei demselben Therapeuten weiterarbeiten zu können, fördert im Rahmen einer intensiven Psychotherapie im Einzelgespräch eine stärkere Auseinandersetzung mit den psychischen Ursachen der Sucht. Nach einer Problemanalyse werden individuelle Ansätze der Konfliktverarbeitung und der Bewältigung erarbeitet.
Rückfallpräventionstraining ist Bestandteil der Entwöhnung
In vielen Kliniken wird der Patient in einer psychoedukativ gestalteten Rückfallprävention auf Rückschläge vorbereitet. Parallel dazu finden auf Patientenwunsch Familien- und/oder Paargespräche statt, in denen einerseits die Begegnung und das Miteinander, andererseits aber auch der konfliktklärende und konstruktive Dialog gefördert werden. Somit kann das Umfeld des Patienten die Abstinenz optimal unterstützen und bei Suchtrückfällen eine wertvolle Hilfe sein. Sind diese Beziehungen ursächlich für die Alkoholabhängigkeit, ist ein Angehörigengespräch ebenfalls zwingend notwendig.
Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) werden in die Behandlung integriert
Sollten zusätzlich zur Alkoholsucht weitere Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel Depressionen, Angstzustände oder Verhaltensstörungen, werden diese im Rahmen des qualifizierten Therapieansatzes mitbehandelt. Ohne entsprechende Behandlung könnten diese Begleiterkrankungen anderenfalls auch nach einer erfolgreichen Therapie schnell einen Rückfall provozieren.
Nachsorgephase
Um nicht in alte Verhaltensmuster zurückzufallen und einen Rückfall zu erleiden, ist nach einem erfolgreichen Alkoholentzug eine umfangreiche und konsequente ambulante Nachsorge sehr wichtig. Dazu gehört auch die Behandlung psychischer, psychosomatischer und somatischer Komorbiditäten, beispielsweise durch eine ambulante Gesprächstherapie bei einem Nachsorgetherapeuten. In dieser können aufkommendes Suchtverlangen, das Zurechtkommen in der sozialen Umgebung und weitere der Abstinenz dienliche Themen besprochen und bearbeitet werden.
Medizinische Behandlung von Komorbiditäten
Bei multimorbiden Patienten muss die ärztliche Behandlung psychiatrisch-neurologischer Erkrankungen unbedingt weitergeführt werden. So werden bei Bedarf physikalische Therapien, kombinierte Schmerztherapien, Sport, Bewegung und Entspannungstraining angeboten.
Selbsthilfegruppen als hilfreiche Stütze nach der Therapie
Ein weiterer wichtiger Baustein des Alkoholentzugs sind Selbsthilfegruppen wie die Anonymen Alkoholiker oder das Blaue Kreuz, in denen die Betroffenen Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig Mut zusprechen und Verständnis erfahren können. Die Teilnehmer sprechen hier völlig offen über das Thema Alkohol und die damit verbundenen Probleme, was innerhalb der Familie oder im Freundeskreis nur selten möglich ist. Häufig entstehen auch intensive soziale Kontakte, welche die erste schwierige Zeit nach dem Alkoholentzug deutlich erleichtern können.

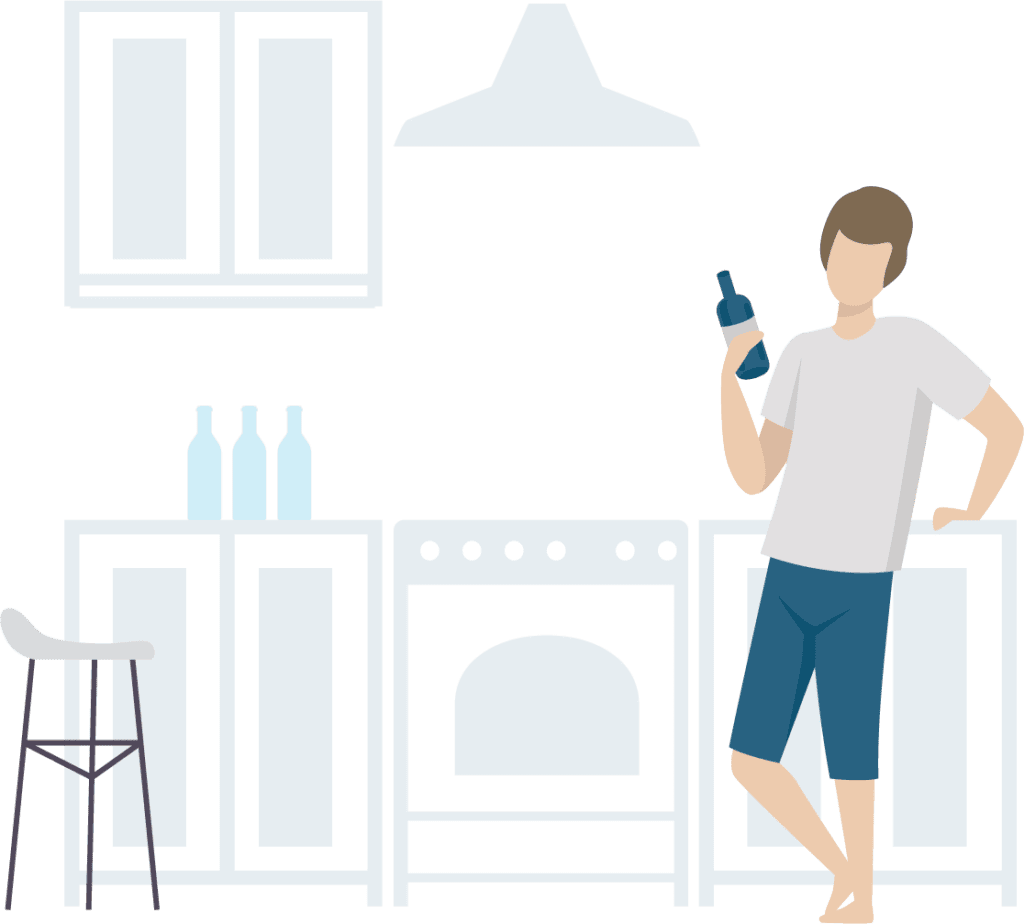 Entgegen dem Volksmund gibt es keine Alkoholmenge, die für Körper und Psyche des Menschen unbedenklich ist. Im Gegenteil: Schon der regelmäßige Genuss kleiner Mengen kann langfristig in eine Sucht führen und den Organismus schädigen. Chronischer Alkoholkonsum erhöht nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen oder Leberschäden, sondern sorgt außerdem für einen Rückgang des Hirnvolumens3.
Entgegen dem Volksmund gibt es keine Alkoholmenge, die für Körper und Psyche des Menschen unbedenklich ist. Im Gegenteil: Schon der regelmäßige Genuss kleiner Mengen kann langfristig in eine Sucht führen und den Organismus schädigen. Chronischer Alkoholkonsum erhöht nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen oder Leberschäden, sondern sorgt außerdem für einen Rückgang des Hirnvolumens3.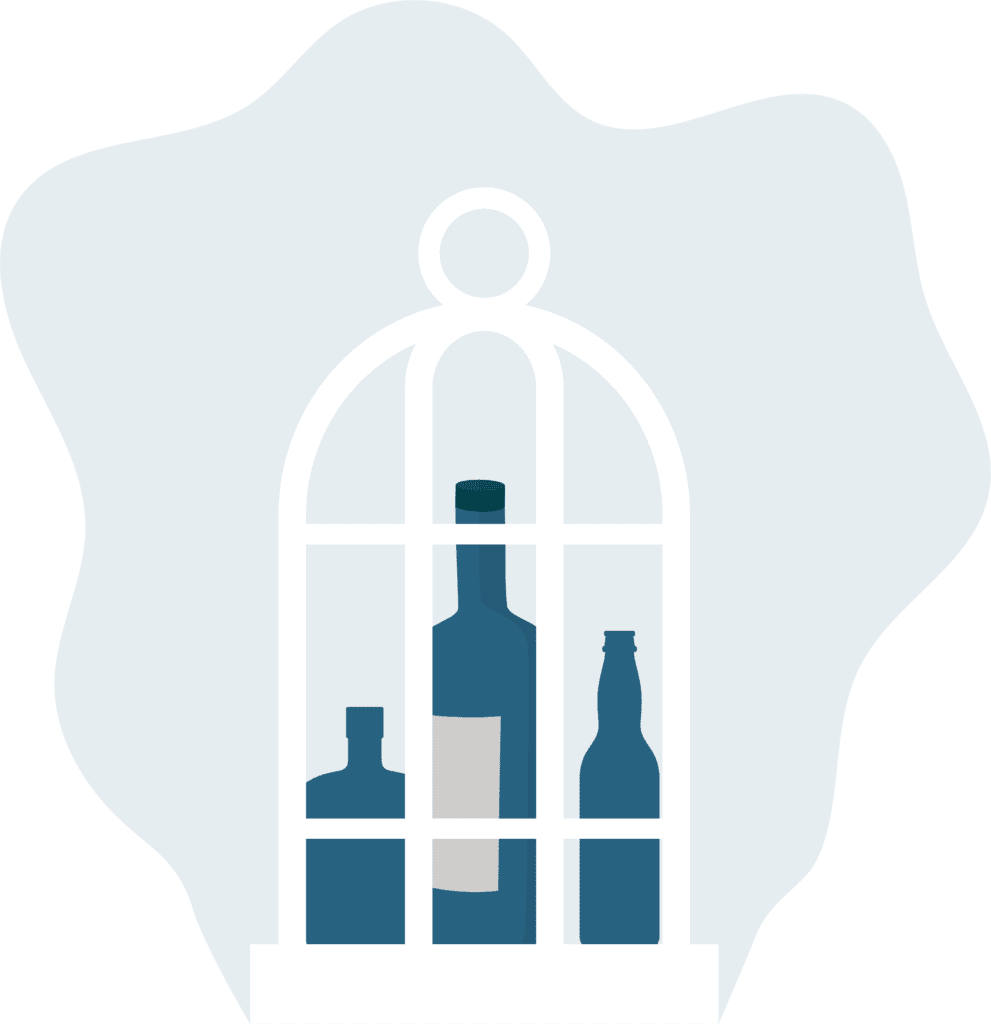 Auch wenn ein qualifizierter, stationärer Alkoholentzug der ambulanten Entzugsvariante grundsätzlich vorzuziehen ist, gibt es Situationen, in denen sich ein ambulanter Alkoholentzug als sinnvoll erweist. Wenn die Hürde zur Annahme eines stationären Angebots zu groß ist, Suchtkranke aus Scham, Angst oder sozialer Verpflichtung keine Alkoholentzugstherapie in einer Klinik absolvieren möchten oder können, ist der qualifizierte ambulante Alkoholentzug eine Alternative. Modellprojekte haben gezeigt, dass auch diese Entzugsvariante in die dauerhafte Abstinenz führen kann4. Hier ist jedoch eine enge Kooperation zwischen Patient, Arzt und einer psychosozialen Beratungsstelle zwingend erforderlich. Erfahrungsgemäß sind ambulante Entzüge deutlich weniger erfolgreich, da Rückfälle z. B. durch die Alltagsumstände deutlich wahrscheinlicher sind.
Auch wenn ein qualifizierter, stationärer Alkoholentzug der ambulanten Entzugsvariante grundsätzlich vorzuziehen ist, gibt es Situationen, in denen sich ein ambulanter Alkoholentzug als sinnvoll erweist. Wenn die Hürde zur Annahme eines stationären Angebots zu groß ist, Suchtkranke aus Scham, Angst oder sozialer Verpflichtung keine Alkoholentzugstherapie in einer Klinik absolvieren möchten oder können, ist der qualifizierte ambulante Alkoholentzug eine Alternative. Modellprojekte haben gezeigt, dass auch diese Entzugsvariante in die dauerhafte Abstinenz führen kann4. Hier ist jedoch eine enge Kooperation zwischen Patient, Arzt und einer psychosozialen Beratungsstelle zwingend erforderlich. Erfahrungsgemäß sind ambulante Entzüge deutlich weniger erfolgreich, da Rückfälle z. B. durch die Alltagsumstände deutlich wahrscheinlicher sind.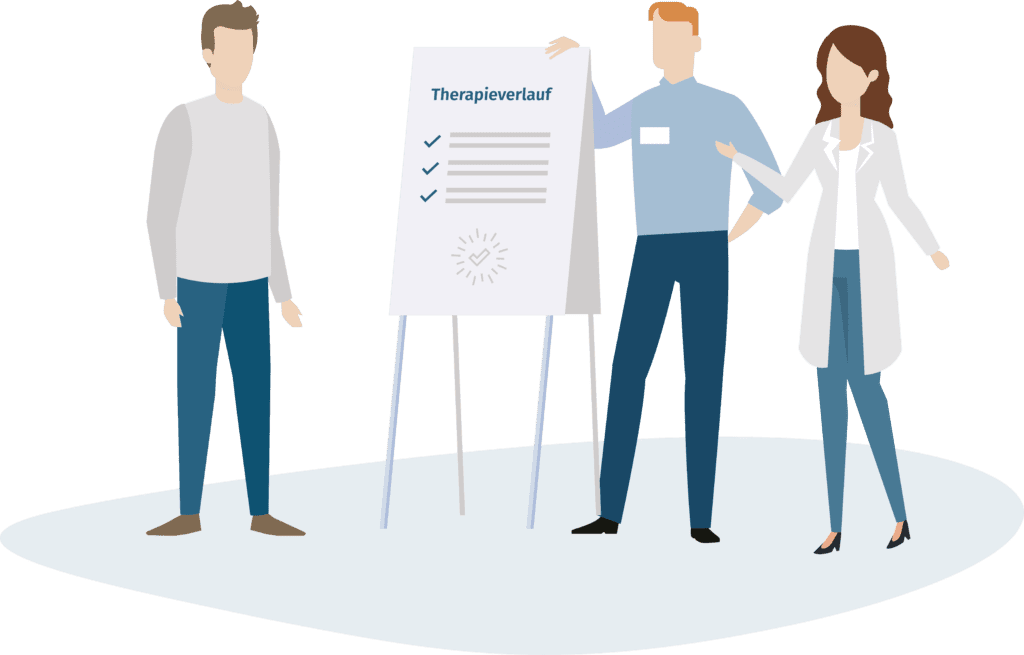 Der Weg aus der Alkoholabhängigkeit erfolgt in mehreren Schritten bzw. Phasen. Je nach Menschen sind diese unterschiedlich ausgeprägt, beinhalten jedoch immer die Vorahnung, die Einsicht des Problems, die Absicht vom Trinken loszukommen, eine konkrete Handlung und die Stabilisierung der Alkohol-Abstinenz. Der gesamte Prozess wird vielfach durch Rückfälle unterbrochen, die den Abhängigen jedoch nicht entmutigen sollten.
Der Weg aus der Alkoholabhängigkeit erfolgt in mehreren Schritten bzw. Phasen. Je nach Menschen sind diese unterschiedlich ausgeprägt, beinhalten jedoch immer die Vorahnung, die Einsicht des Problems, die Absicht vom Trinken loszukommen, eine konkrete Handlung und die Stabilisierung der Alkohol-Abstinenz. Der gesamte Prozess wird vielfach durch Rückfälle unterbrochen, die den Abhängigen jedoch nicht entmutigen sollten.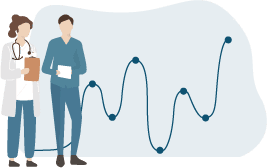 Die
Die