Wie ist eine Suchtbehandlung aufgebaut?
Wer unter einer Suchterkrankung leidet und den Weg aus der Abhängigkeit schaffen möchte, muss in der Regel vier verschiedene Phasen oder Stufen bewältigen. Diese bauen unmittelbar aufeinander auf und sollten allesamt durchlaufen werden, um die langfristige Abstinenz erreichen zu können. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um eine Alkoholsucht, eine Medikamentenabhängigkeit oder ein Drogenproblem handelt. Die Therapie verläuft immer in denselben Schritten und unterscheidet sich lediglich in ihrer Länge.
Erstkontakt und Motivation
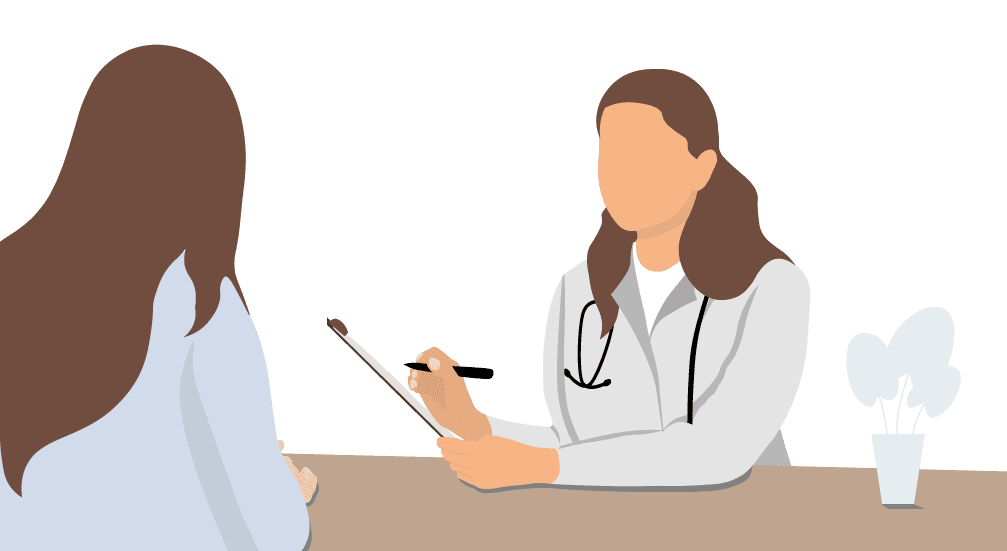 Sobald Patienten merken, dass sie an einer Suchterkrankung leiden, sollten sie sich um einen Erstkontakt mit einer Fachklinik, einem Arzt oder einer ambulanten Suchtberatung bemühen. Oftmals ist diese erste Phase für suchtkranke Menschen der schwerste Schritt. Vielen Alkoholkranken oder Drogenabhängigen fällt es leichter, sich zunächst an eine Vertrauensperson wie zum Beispiel den Partner, einen guten Freund oder einen nahen Verwandten zu wenden. Diese können dann gemeinsam mit ihnen den wichtigen Weg zu einer Suchtberatung oder zum Hausarzt einschlagen.
Sobald Patienten merken, dass sie an einer Suchterkrankung leiden, sollten sie sich um einen Erstkontakt mit einer Fachklinik, einem Arzt oder einer ambulanten Suchtberatung bemühen. Oftmals ist diese erste Phase für suchtkranke Menschen der schwerste Schritt. Vielen Alkoholkranken oder Drogenabhängigen fällt es leichter, sich zunächst an eine Vertrauensperson wie zum Beispiel den Partner, einen guten Freund oder einen nahen Verwandten zu wenden. Diese können dann gemeinsam mit ihnen den wichtigen Weg zu einer Suchtberatung oder zum Hausarzt einschlagen.
Körperlicher Entzug
Wer von Drogen, Alkohol oder Pharmazeutika abhängig ist, muss im zweiten Schritt die körperliche Entzugsphase hinter sich bringen. Da diese für den Patienten mit Entzugserscheinungen und zum Teil lebensgefährlichen Nebenwirkungen verbunden ist, erfolgt sie im Normalfall stationär. Bei einer stationären Therapie in einer qualifizierten Suchtklinik verordnen erfahrene Suchtmediziner meist schmerzlindernde, krampflösende oder psychopharmazeutische Arzneimittel zur Linderung der Symptome und kontrollieren die Vitalfunktionen engmaschig. In privaten Kliniken steht darüber hinaus ein breit gefächertes Spektrum begleitender Therapien zur Verfügung, welche die körperlichen Entzugserscheinungen zusätzlich lindern können.
Entwöhnungsbehandlung
Alkohol, Medikamente oder Drogen fungieren häufig als Problemlöser und gestalten den Alltag für abhängige Menschen vermeintlich erträglicher. Sie vermitteln kurzfristig Selbstbewusstsein und Stärke und nehmen die Angst vor kritischen Situationen. Daher leiden Suchtkranke während des qualifizierten Entzugs nicht nur am Entzugssyndrom, sondern fallen meist ebenfalls psychisch in ein tiefes Loch. Es scheint ihnen nicht möglich, ohne den Suchtstoff zu existieren. Genau hier setzt die stationäre Entwöhnungsbehandlung an.
Weshalb wird überhaupt zum Suchtmittel gegriffen? Welche Alternativen gibt es? Gibt es Begleiterkrankungen, die zusätzlich an den Kräften zehren, beispielsweise Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen? War bereits ein Elternteil alkoholkrank? Wie ist das soziale Umfeld des Betroffenen beschaffen? So besitzt jeder Mensch eine persönliche Suchtgeschichte, die während der Entwöhnung therapeutisch aufgearbeitet wird. Diese Auseinandersetzung mit der Abhängigkeitserkrankung stellt die Patienten einerseits zwar oft vor eine große Herausforderung, führt andererseits aber auch zu innerer Stärke und einer besseren Selbstkenntnis. Daher ist sie zwingend erforderlich, um langfristig ohne Substanzkonsum leben zu können.
Ambulante Nachsorge
 Durch die Entwicklung des sogenannten Suchtgedächtnisses ist die vollständige Heilung einer stoffgebundenen Sucht nicht möglich. Selbst während der Abstinenz besteht jederzeit die Gefahr eines Rückfalls. Daher ist es wichtig, nach Abschluss des stationären Aufenthalts eine ambulante Therapie anzuschließen und das während der Suchttherapie Erlernte auch nach dem Entzug zu stabilisieren. Dazu gehört der Besuch eines ambulanten Nachsorgetherapeuten und idealerweise die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe wie den Anonymen Alkoholikern.
Durch die Entwicklung des sogenannten Suchtgedächtnisses ist die vollständige Heilung einer stoffgebundenen Sucht nicht möglich. Selbst während der Abstinenz besteht jederzeit die Gefahr eines Rückfalls. Daher ist es wichtig, nach Abschluss des stationären Aufenthalts eine ambulante Therapie anzuschließen und das während der Suchttherapie Erlernte auch nach dem Entzug zu stabilisieren. Dazu gehört der Besuch eines ambulanten Nachsorgetherapeuten und idealerweise die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe wie den Anonymen Alkoholikern.
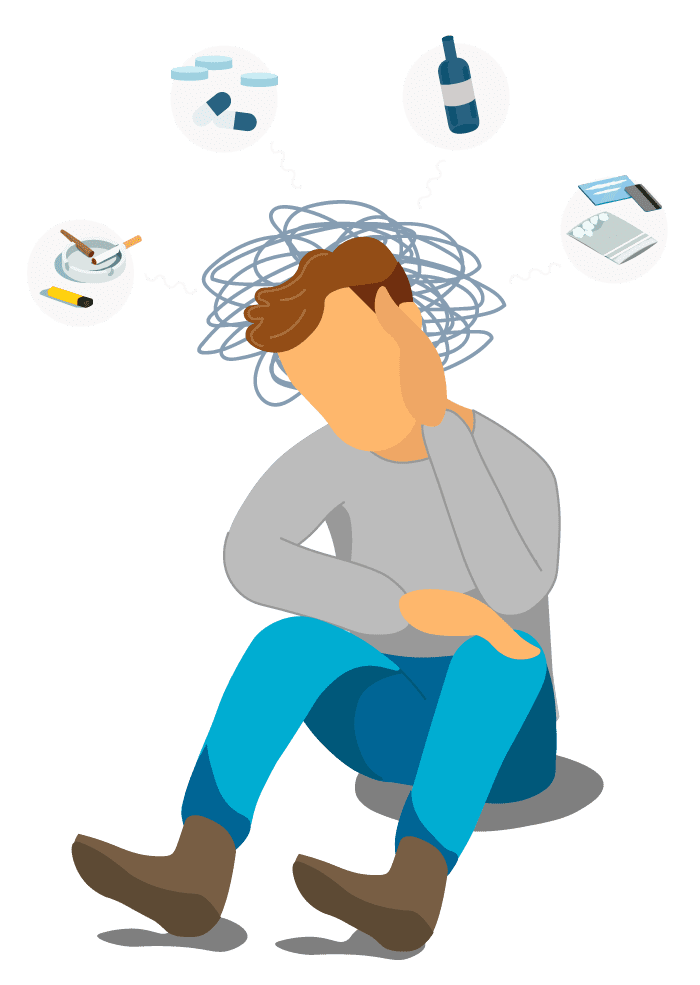 Eine Sucht kann sowohl von Alkohol als auch von bestimmten Medikamenten oder Drogen hervorgerufen werden. Obwohl es sich auf den ersten Blick um völlig unterschiedliche Suchtmittel handelt, haben alle Substanzen eine Gemeinsamkeit. Sie greifen aktiv in den Neurotransmitter-Stoffwechsel des zentralen Nervensystems ein und erzeugen dort eine psychoaktive Wirkung, die bei längerem Konsum zur Suchtentwicklung führt. Bei den Medikamenten sind es in erster Linie
Eine Sucht kann sowohl von Alkohol als auch von bestimmten Medikamenten oder Drogen hervorgerufen werden. Obwohl es sich auf den ersten Blick um völlig unterschiedliche Suchtmittel handelt, haben alle Substanzen eine Gemeinsamkeit. Sie greifen aktiv in den Neurotransmitter-Stoffwechsel des zentralen Nervensystems ein und erzeugen dort eine psychoaktive Wirkung, die bei längerem Konsum zur Suchtentwicklung führt. Bei den Medikamenten sind es in erster Linie 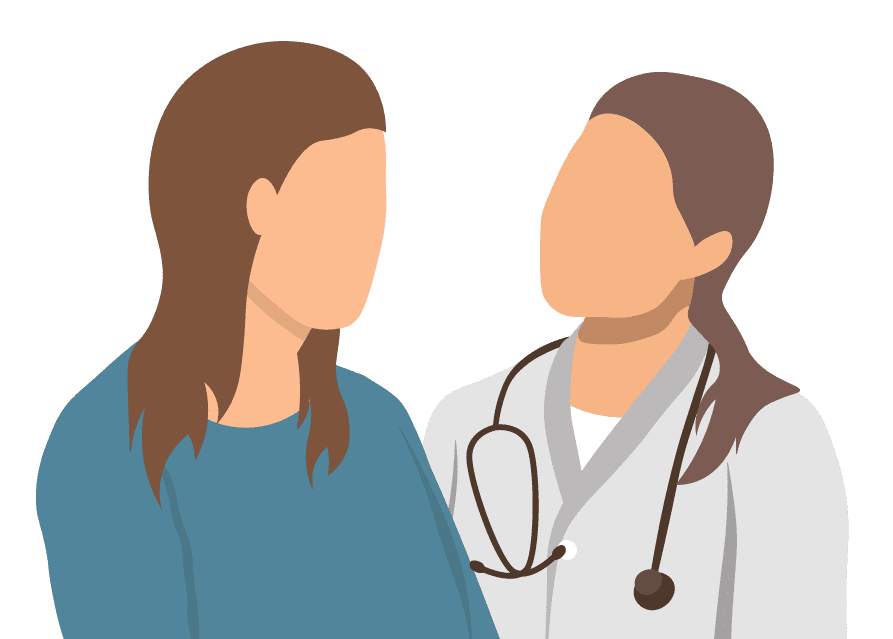 rückfällig. Ebenso kann die Durchführung eines Entzugs in Eigenregie gefährlich werden. So erleiden 5 bis 15 % aller Alkoholkranken in der Entgiftungsphase das sogenannte Delirium tremens, das mit heftigen Krampfanfällen verbunden ist und schlimmstenfalls zu Koma und Tod führen kann.
rückfällig. Ebenso kann die Durchführung eines Entzugs in Eigenregie gefährlich werden. So erleiden 5 bis 15 % aller Alkoholkranken in der Entgiftungsphase das sogenannte Delirium tremens, das mit heftigen Krampfanfällen verbunden ist und schlimmstenfalls zu Koma und Tod führen kann.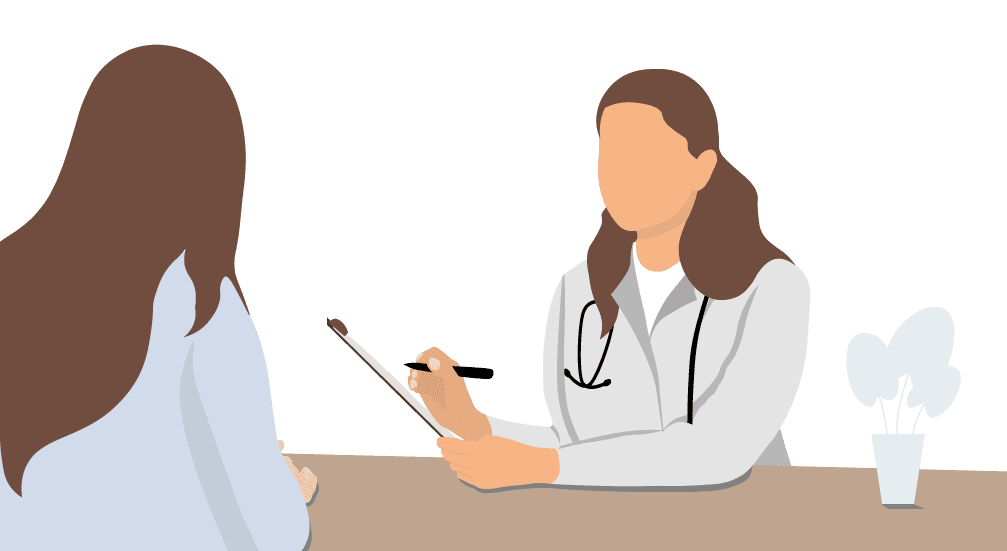 Sobald Patienten merken, dass sie an einer Suchterkrankung leiden, sollten sie sich um einen Erstkontakt mit einer Fachklinik, einem Arzt oder einer ambulanten Suchtberatung bemühen. Oftmals ist diese erste Phase für suchtkranke Menschen der schwerste Schritt. Vielen Alkoholkranken oder Drogenabhängigen fällt es leichter, sich zunächst an eine Vertrauensperson wie zum Beispiel den Partner, einen guten Freund oder einen nahen Verwandten zu wenden. Diese können dann gemeinsam mit ihnen den wichtigen Weg zu einer Suchtberatung oder zum Hausarzt einschlagen.
Sobald Patienten merken, dass sie an einer Suchterkrankung leiden, sollten sie sich um einen Erstkontakt mit einer Fachklinik, einem Arzt oder einer ambulanten Suchtberatung bemühen. Oftmals ist diese erste Phase für suchtkranke Menschen der schwerste Schritt. Vielen Alkoholkranken oder Drogenabhängigen fällt es leichter, sich zunächst an eine Vertrauensperson wie zum Beispiel den Partner, einen guten Freund oder einen nahen Verwandten zu wenden. Diese können dann gemeinsam mit ihnen den wichtigen Weg zu einer Suchtberatung oder zum Hausarzt einschlagen. Durch die Entwicklung des sogenannten Suchtgedächtnisses ist die vollständige Heilung einer stoffgebundenen Sucht nicht möglich. Selbst während der Abstinenz besteht jederzeit die Gefahr eines Rückfalls. Daher ist es wichtig, nach Abschluss des stationären Aufenthalts eine ambulante Therapie anzuschließen und das während der Suchttherapie Erlernte auch nach dem Entzug zu stabilisieren. Dazu gehört der Besuch eines ambulanten Nachsorgetherapeuten und idealerweise die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe wie den Anonymen Alkoholikern.
Durch die Entwicklung des sogenannten Suchtgedächtnisses ist die vollständige Heilung einer stoffgebundenen Sucht nicht möglich. Selbst während der Abstinenz besteht jederzeit die Gefahr eines Rückfalls. Daher ist es wichtig, nach Abschluss des stationären Aufenthalts eine ambulante Therapie anzuschließen und das während der Suchttherapie Erlernte auch nach dem Entzug zu stabilisieren. Dazu gehört der Besuch eines ambulanten Nachsorgetherapeuten und idealerweise die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe wie den Anonymen Alkoholikern.
