Eine mögliche Entstehungsgeschichte
Frau Meier (Name fiktiv) führt ein durchschnittliches Leben. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung hat sie ihren langjährigen Partner geheiratet und kurze Zeit später bekam das Paar Nachwuchs. Frau Meier gab ihre Arbeit auf und kümmerte sich allein um die Kinder und den Haushalt, während ihr Mann in Vollzeit beschäftigt war.
Als die Kinder älter wurden und ihr immer mehr Freizeit zur Verfügung stand, begann sich Frau Meier zu langweilen und an ihrem Leben und der Sinnhaftigkeit zu zweifeln. Um ihren Ausbildungsberuf wieder aufzunehmen, fühlte sie sich zu alt, etwas anderes hingegen hatte sie nie gelernt. Um das entstehende Gefühl der Wertlosigkeit und die ständigen Grübeleien zu betäuben, gönnte sich Frau Meier hin und wieder ein Glas Prosecco. Dieser hob ihre Laune im Nu und sie fühlte sich bereits nach wenigen Schlucken deutlich besser.
Zunächst trank sie nur an zwei oder drei Abenden wöchentlich ein Glas. Ein paar Monate später waren es schon zwei oder drei Gläser täglich. Tatsächlich schien die gewohnte Menge Alkohol auf Dauer nicht mehr ganz so beruhigend und angenehm zu wirken, sodass Frau Meier die Menge erhöhte. Irgendwann trank sie das erste Mal auch nachmittags – sie hatte in letzter Zeit immer so ein leichtes Zittern in den Händen bemerkt, das auf “wundersame Weise” verschwand, wenn sie auch bereits nach dem Mittagessen ein paar Schlückchen Prosecco trank. Weshalb sollte sie nur am Abend gut gelaunt und munter sein? Viel schöner war es doch, wenn sie sich den ganzen Tag über gut fühlte. Schon nach dem Aufstehen freute sie sich deshalb auf den Augenblick, an dem sie das erste Mal etwas trinken konnte.
Aus Scham und Schuldgefühlen konsumierte Frau Meier den Alkohol heimlich. Die leeren Flaschen entsorgte sie meist direkt am nächsten Tag; gegen die leichte Fahne halfen Kaugummis oder stark gewürzte Gerichte. Über eine Alkoholabhängigkeit machte Frau Meier sich keine Gedanken – schließlich trank sie ja nie so viel, dass sie einen Vollrausch hatte. Außerdem konnte sie ja jederzeit wieder mit dem Trinken aufhören. Oder etwa nicht?


 Die Abhängigkeit entwickelt sich in vielen Fällen über mehrere Jahre hinweg und wird zumindest anfänglich häufig verleugnet. Bis die Betroffenen sich konstruktiv mit ihrer Sucht auseinandersetzen, hat sich das schädliche Trinkverhalten meist schon fest etabliert und ist nur noch mit einem qualifizierten
Die Abhängigkeit entwickelt sich in vielen Fällen über mehrere Jahre hinweg und wird zumindest anfänglich häufig verleugnet. Bis die Betroffenen sich konstruktiv mit ihrer Sucht auseinandersetzen, hat sich das schädliche Trinkverhalten meist schon fest etabliert und ist nur noch mit einem qualifizierten 
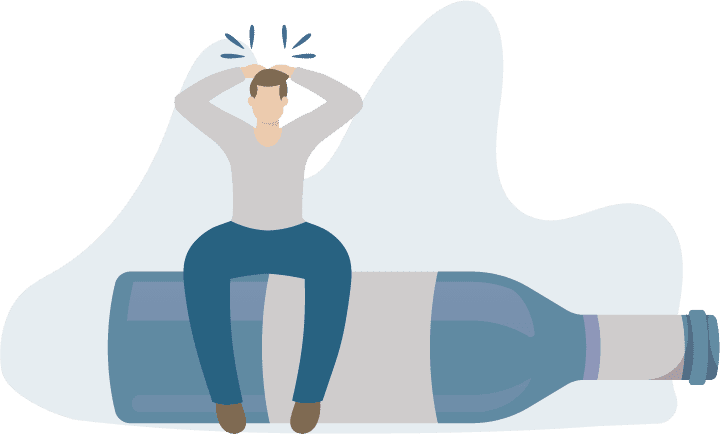
 Gründe für eine Alkoholkrankheit gibt es viele. Die Entstehungsgeschichte ist stets multikausal, also in einer Kombination von Gründen zu suchen. Bei Frau Meier sind es Langeweile, Unzufriedenheit mit ihrer aktuellen Lebenssituation und ein geringes Selbstwertgefühl, sowie fehlende, günstige Kompensationsstrategien. Andere Alkoholiker haben irgendwann begonnen zur Flasche zu greifen, weil sie vom Stress an der Arbeit abschalten wollten, weil sie die Symptome einer Angststörung betäuben möchten oder weil ihr Partner sie verlassen hat und sie den Kummer nicht ohne „Hilfsmittel“ bewältigen können.
Gründe für eine Alkoholkrankheit gibt es viele. Die Entstehungsgeschichte ist stets multikausal, also in einer Kombination von Gründen zu suchen. Bei Frau Meier sind es Langeweile, Unzufriedenheit mit ihrer aktuellen Lebenssituation und ein geringes Selbstwertgefühl, sowie fehlende, günstige Kompensationsstrategien. Andere Alkoholiker haben irgendwann begonnen zur Flasche zu greifen, weil sie vom Stress an der Arbeit abschalten wollten, weil sie die Symptome einer Angststörung betäuben möchten oder weil ihr Partner sie verlassen hat und sie den Kummer nicht ohne „Hilfsmittel“ bewältigen können.

